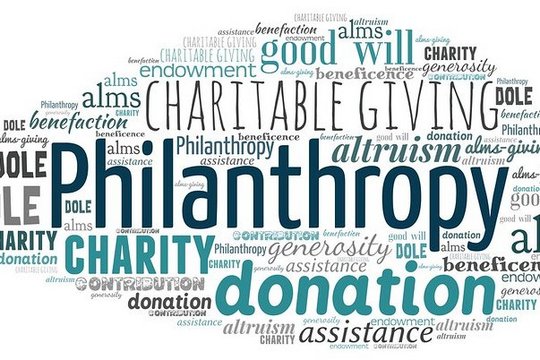Der tibetisch buddhistische Yonghe Tempel in Peking verzeichnet zur Zeit einen großen Besucher:innenansturm. Junge Chines:innen beten für Erfolg bei Prüfungen, Bewerbungen und ihre berufliche Karriere im Allgemeinen. Ein Grund für die jüngste Beliebtheit des Ortes ist die Jugendarbeitslosenrate in China, welche derzeit Rekordhöhen erreicht. Wie das Statistikamt der chinesischen Regierung Mitte Juli bekannt gab, erreichte die Arbeitslosenquote der 16 bis 24 jährigen in urbanen Regionen der Volksrepublik im Juni 21,3 Prozent. Damit ist jede:r fünfte Chines:in ohne Arbeitsstelle, was auch die knapp 12 Millionen neuen Hochschulabsolvent:innen betrifft, welche dieses Jahr in China auf Jobsuche gehen.
Wie reagieren junge Chines:innen auf diese Situation? Was tut die chinesische Regierung, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen? Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf Chinas Gesellschaft und ihr Verhältnis zu der regierenden Partei?
Tempelbesuche aus Sorge statt Frömmigkeit
Auf dem Tempelgelände im Zentrum Pekings erzählt eine junge Frau einem deutschen Journalisten, dass junge Menschen nicht beten, weil sie religiös seien, sondern um etwas zu erreichen. Sie beschreibt die Ängste, welche mit dem marktwirtschaftlichen Charakter des Bildungs- und Arbeitssystems in China einhergehen, in welchem sich Studierende und Hochschulabsolvent:innen unter immer mehr Druck und Konkurrenz behaupten müssen. Ihre Eltern hingegen haben damals von der Regierung Arbeit zugeteilt bekommen. Die hohe Arbeitslosigkeit ihrer Generation bereite ihr zusätzliche Sorgen, sagt sie, und die Situation werde ihrer Einschätzung nach noch länger andauern.
Ein anderer Besucher schildert seine Wahrnehmung der Situation als eine für einzelne Menschen wie ihn vorübergehende, aber für die Gesellschaft anhaltende Problematik. Das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft zu verlieren, ginge schnell, es zurückzugewinnen, dauere sehr lange. Das Problem bestehe darüber hinaus nicht erst seit der Covid-19 Pandemie, sondern liege tiefer, sagt er. Die demographische Entwicklung, Wirtschaftsabschwung und Verschuldung seien die eigentlichen Ursachen, zusammen mit der Priorisierung von Sicherheit und Nationalismus der Regierung über dem Unternehmertum. In China dienen die dynamische wirtschaftliche Entwicklungen seit Jahrzehnten als Legitimation der Herrschaft der Kommunistischen Partei.
Ursachen der Situation
Die Asia Development Bank hat ebenfalls einige Faktoren ausmachen können, die zur derzeitigen Lage beigetragen haben. Da viele junge Chines:innen im Dienstleistungssektor oder bei Privatunternehmen beschäftigt waren, trafen sie die Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Folgen für den Arbeitsmarkt besonders hart. Gleichzeitig wurden im Vergleich zu den Jahren vor Covid-19 kaum neue Stellen geschaffen. Während die Jugendarbeitslosenrate vor der Pandemie bei 11,9 Prozent lag, hat sie sich seitdem etwa verdoppelt.
Als zweiten Faktor werden die steigenden Hochschulabsolvent:innenzahlen genannt. Allein 2022 haben 1,7 Millionen Studierende mehr den Sprung von der Hochschule in die Berufswelt gemacht als im Vorjahr. Das Bildungsministerium Chinas gab im letzten Jahr an, dass sich der Anteil der Schüler:innen, welche nach der Sekundarstufe die Hochschule besuchen, seit 2012 verdoppelt habe. Eine universitäre Bildung stellt für chinesische Eltern immer noch den Weg zu wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg dar. Dies erhöht den Druck auf junge Menschen zusätzlich.
Ein weiteres Problem besteht im Ungleichgewicht der Arbeitskräfte und der verfügbaren Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Während Fabriken händeringend nach Arbeitskräften suchen, finden Hochschulabsolvent:innen keine Stellen, die zu ihrem Profil passen. Die Absolvent:innen bringen ihre eigenen, wie auch die Erwartungen ihrer Eltern an ihre beruflichen Tätigkeiten mit in die Jobsuche, dies erschwert den Prozess. Im Vergleich zu praktischer ausgebildeten Chines:innen stehen Hochschulabsolvent:innen zudem deutlich weniger offenen Stellen gegenüber, die zu ihrem Profil passen. Die Suche nach Stellen wird demnach zusätzlich durch den Unterschied zwischen erworbenen Fähigkeiten und den von Arbeitgebern gefragten Fähigkeiten erschwert. Zu alldem litt die Qualität der Bildung sowie Praktikumsmöglichkeiten unter den Lockdowns der Covid-19 Pandemie, was Absolvent:innen der entsprechenden Jahrgänge gegenüber Konkurrent:innen bei der Stellensuche weiter benachteiligt.
Wenig Optimismus bei jungen Chines:innen
Biao Xiang ist Professor mit dem Forschungsschwerpunkt auf Chinas Generation Z, also den aktuellen Hochschulabsolvent:innen, und bestätigt, dass es in China momentan „zu viele gut Ausgebildete für zu wenig gut angesehene Karrieren gebe“. Diese Überqualifizierung und Unterbeschäftigung, wie sie auch von der Asia Development Bank benannt wurde, trage auch zu der hohen Jugendarbeitslosenrate in China bei. Das Leben der Schüler:innen und Studierenden in China beschreibt Xiang als einen „Teufelskreis des Konkurrenzkampfes“. Im Chinesischen gibt es eine Wortneuschöpfung, mit der Chines:innen das Phänomen beschreiben: 内卷, zu Deutsch etwa gleichzusetzen mit “im Hamsterrad” aufgrund des nicht endenden Konkurrenzkampfes. Xiang erklärt, dass man in China von Beginn der Schulzeit an gezwungen sei, an dem unaufhörlichen Wettbewerb teilzunehmen. „Man strengt sich endlos an – ohne einen wirklichen Sinn“. Dabei gehe es heutzutage weniger darum, die Nummer eins zu sein, sondern lediglich darum, nicht gegenüber den anderen zurückzufallen. Daher sei bei jungen Chines:innen inzwischen nicht mehr Ehrgeiz, sondern Angst die treibende Kraft.
Nach Jahren der Anstrengung im Hamsterrad des chinesischen Bildungssystems macht sich im Angesicht der aktuellen Arbeitsmarktsituation bei vielen Chines:innen Pessimismus breit. Ein Angestellter einer Kunstgalerie erklärt, dass die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs während der Periode der Reform und Öffnung in den 1980er Jahren „voller Hoffnung“ gewesen sei. Heute sei das nicht mehr so, Klassenunterschiede könne man nicht mehr leicht durch Bildung überwinden. Er habe sich sogar dagegen entschieden, Kinder zu bekommen, solange sich nicht etwas grundlegend ändere. Was diese Veränderung sein könnte, lässt er jedoch offen.
Einige politische Regulierungen der letzten Jahre haben ebenfalls zum Frust der jungen Chines:innen beigetragen. Als 2021 die gewinnorientierte Nachhilfe in China überraschend verboten wurde, verloren viele Studierende einerseits eine wichtige Nebeneinkommensquelle und Übergangsbeschäftigung nach dem Abschluss, andererseits wurde das Bestehen der Universitätsaufnahmeprüfungen chin.: 高考 wieder verstärkt in der Öffentlichkeit in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit gebracht. Auch in der Technologiebranche herrscht Verunsicherung, nachdem eine Regulierungswelle, im Rahmen der Versicherheitlichung zahlreicher Bereiche, gegen die größten Konzerne des Landes den Sektor geschwächt hat. Studierende der entsprechenden Fachbereiche sehen in Hinblick auf ihren bevorstehenden Abschluss der Vielzahl an Entlassungen im Sektor mit Sorge zu. Die Ausschreibungen für neue Stellen bleiben ebenfalls vorerst entsprechend gering.
Ausdrücke der Unzufriedenheit
Junge Chines:innen äußern ihren Unmut zunehmend auch im Internet. Dabei werden Beiträge und Kommentare oft innerhalb kürzester Zeit von Zensoren gelöscht. Ein Lied über den fiktiven Charakter Kong Yiji des Schriftstellers Lu Xun beschreibt die Geschichte und das Leben Kongs, in welchem er als armer Gelehrter den Hunger der körperlichen Arbeit vorzieht. Das Lied traf den Nerv einer ganzen Generation studierter Chines:innen und wurde im Mai diesen Jahres mit 4 Millionen Aufrufen an einem Tag zum viralen Hit, woraufhin es von den Zensoren gelöscht wurde.
Ein weiterer interessanter Trend sind mit sarkastischen und zynischen Botschaften gespickte Abschlussfotos der Absolvent:innen, bei denen sie ihre Erschöpfung oder die vermeintliche Wertlosigkeit ihrer Abschlusszertifikate darstellen. Während klassische Abschlussfotos in der Vergangenheit stolze Absolvent:innen und Familien zeigten, oder auch Blumensträuße und fliegende Hüte, liegen die jungen Chines:innen dieses Jahr teilweise mit dem Gesicht auf dem Boden oder deuten an, ihr Zeugnis in den Müll zu werfen. Ein chinesischer Internetnutzer kommentierte den Trend mit Sympathie: „Ich liebe diesen Stil der Abschlussfotos, er trifft genau meinen halbtoten Lebenszustand“. Auf den seit einiger Zeit im chinesischen Internet bekannten Trend des „Flachliegens“ chin.: 躺平, scheint ebenfalls durch die Bilder angespielt zu werden. Der Begriff beschreibt den Akt des Kündigens und des Nichtstuns, um stattdessen eigene Interessen und Entspannung dem ewigen Konkurrenzkampf vorzuziehen. Viele Chines:innen ließen sich von der Bewegung inspirieren und finden seitdem zu mehr Ruhe und individueller Lebensgestaltung. Einige arbeiten in weniger kompetitiven Tätigkeitsbereichen weiter, einige machen ein paar Wochen oder Monate Pause, und wieder andere versuchen sich vorerst auf unbestimmte Zeit dem Arbeitsalltag zu entziehen. Der Trend zeigt eine deutliche Tendenz der Unzufriedenheit mit dem Hamsterrad der Berufswelt und eine erhöhte Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse sowie den Wunsch nach persönlicher Lebensgestaltung. Der Unterschied zum gesellschaftlichen Empfinden der vorangegangenen Generationen und derer die das Land aktuell führen ist groß.
Die Antwort der Regierung
Zum Tag der Jugend im Mai wurde ein Antwortschreiben Xi Jinpings auf einen Brief von Studierenden der Agrarwissenschaften veröffentlicht, in dem er junge Menschen lobte, welche „Bitterkeit essen“ 吃苦 und „selbst Bitterkeit zum essen suchen“ 自找苦吃. Die Bedeutung dieser chinesischen Redewendungen ist, Strapazen zu ertragen und sich Problemen zu stellen. Die Implikation der Aussagen ist dabei, dass sich die jungen chinesischen Hochschulabsolvent:innen nicht zu fein für körperliche Arbeit sein sollten. Xi Jinping erinnert in seinem Schreiben daran, wie er selbst als junger Mann fleißig auf dem Land härteste und schmutzigste Arbeit verrichtet hat, trotz seiner höheren Bildung. Der Appell ist eindeutig: Jungen Chines:innen müssen sich für das Land einsetzen und dort anpacken, wo Arbeit anfällt, unabhängig vom Bildungsgrad. Die Kommunistische Jugendliga unterstütze Xis Worte und rief die Absolvent:innen online dazu auf, ihre „Studiengewänder auszuziehen“ und sich nicht „zu fein dafür zu sein, ihre Hosen hochzukrempeln und auf die Felder zu gehen“. Diese Worte erinnern jedoch viele Chinesinnen und Chinesen an das dunkle Kapitel der Landverschickung während der chinesischen Kulturrevolution, und angesichts der Situation empfinden junge Internetnutzer:innen die Aussagen der Regierung als wenig hilfreich und sogar herablassend spöttisch ihnen gegenüber.
Das öffentliche Austragen des Frusts junger Chines:innen und dessen Verbreitung im Internet werden von der Regierung unterbunden. Xi Jinping riet den jungen Leuten zum Tag der Jugend, realistischere Ziele zu verfolgen und mehr auf die Partei zu hören. Die Aussage scheint Hand in Hand zu gehen mit dem zum Monatsbeginn verabschiedeten Gesetz zur Förderung des Patriotismusgesetzes in der Bildung. Jochen Stahnke von der FAZ erkennt die Aussagen Xis und der Kommunistischen Jugendliga als „Unterordnung des persönlichen Strebens zugunsten vermeintlich kollektiver Interessen“. Der unausgesprochene Gesellschaftsvertrag, der individuellen Wohlstand durch wirtschaftlichen Aufschwung versprach und im Gegenzug politischen Gehorsam erwartete, beginnt nun zu bröckeln. Die Jugendarbeitslosenrate sorgt demnach auch für eine politisch äußerst geladene Situation, was die Bemühung um Zensur der Internetbeiträge erklärt. Nach 15 Jahren in Schule und Universität, im Hamsterrad des Wettbewerbs enormem Druck ausgesetzt, mit dem Versprechen motiviert, mehr Bildung und bessere Noten brächten Wohlstand und Sicherheit, fühlen sich die Absolvent:innen entsprechend desillusioniert. Der Trend der sarkastischen Abschlussfotos zeugt von ebendiesem Gefühl: Zeugnisse werden als wertlos dargestellt, Absolvent:innen ziehen sich erschöpft von Konkurrenzkampf und Leistungsdruck zurück. Im Angesicht der Zensur von Kommentaren im Internet und mangels anderer Möglichkeiten des freien Ausdrucks der Frustration mit der Lage, deuten diese besonderen Abschlussfotos wie auch das Flachliegen eine Art des leisen Protests an.
Piet Kortenjan