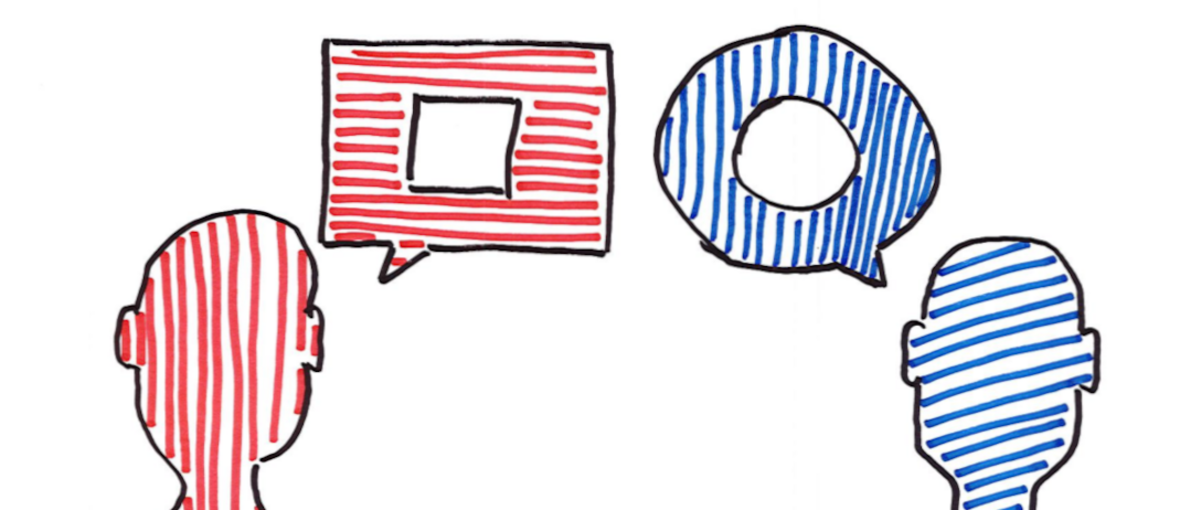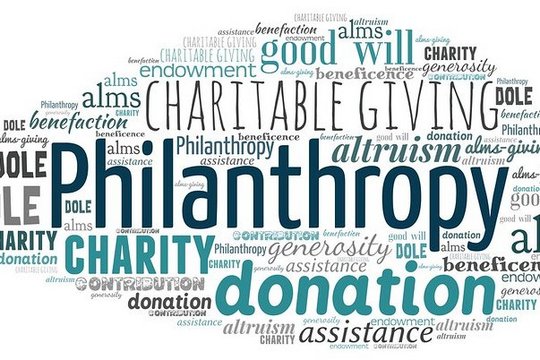Die chinesische Zivilgesellschaft bleibt für Menschen ohne konkreten Bezug zu diesem Sektor ein blinder Fleck. Um diesen Bereich besser zu verstehen, ist es entscheidend, nicht nur die politischen Rahmenbedingungen zu kennen, auf die wir uns in unserem Blickwechsel fokussiert haben, sondern auch Einblicke in die chinesische Kritikkultur zu gewinnen. In diesem Artikel möchten wir Wege und Möglichkeiten der kritischen Meinungsäußerung im heutigen China aufzeigen und so zu einem differenzierteren Chinabild beitragen.
Im Rahmen der Einsteigerakademie China, veranstaltet vom Bildungsnetzwerk China in Kooperation mit Bildung und Begabung, führte Leonie Suna-Kiefer mit einer chinesischen Kollegin, Lei Wang, den Kurs „Philosophie und Praxis des Nein-Sagens – Streit und Konfliktkultur in China“ durch. Die Kursteilnehmenden hatten, wie zu erwarten war, ein Bild von Chines:innen im Kopf, die keine Kritik üben dürfen und dies auch nicht tun. Ein unterdrückender Staat, ohne Raum für diverse Meinungen und politischen Aktivismus, so die weit verbreitete Sicht auf die Volksrepublik. Immer wieder begegnet auch uns im China-Programm der Stiftung Asienhaus die Frage: Zivilgesellschaft in China – gibt es das überhaupt noch? Und, Dialog mit China - wie soll das funktionieren?
Recht auf freie Meinungsäußerung?
Während in Deutschland Debatten im Rahmen der „deutschen Streitkultur“ an der Tagesordnung sind, steht in China nicht nur im politischen, sondern auch im kulturellen Leben, das Konzept der sozialen Stabilität und des harmonischen Zusammenlebens im Vordergrund. Mit dem Neinsagen, dem Widersprechen gegen vermeintliche gesellschaftliche Normen, wird eine vielfältige, diverse und authentische Gesellschaft gebildet. Im Rahmen dieses Artikels gilt es zu betonen, dass die politischen Strukturen in China eine freie, kritische Meinungsäußerung häufig nur unter Inkaufnahme negativer Konsequenzen unterschiedlich schwerer Ausprägung für das Individuum und oftmals auch dessen Angehörige möglich machen. In Artikel 35 der chinesischen Verfassung heißt es zwar: „Die Bürger der Volksrepublik China genießen Rede-, Presse-, Versammlungs-, Vereinigungs-, Prozessions- und Demonstrationsfreiheit.“ […] In der Praxis jedoch schränkt die regierende Kommunistische Partei Chinas die Ausübung der Meinungsfreiheit erheblich ein, da die Auslegung von Redefreiheit wie im Decoding China Dictionary erläutert, Beschränkungen der Erhaltung der Stabilität des Staates obliegt. Proteste, Demonstrationen und andere Formen der gesellschaftlichen Kritik, wie wir sie ganz selbstverständlich aus Deutschland kennen, können für Teilnehmende in China ein erhebliches Risiko darstellen.
In diesem Artikel ist von kulturellen Eigenschaften „der deutschen“ und „der chinesischen“ Gesellschaft die Rede. Dabei soll ein generalisierender Kulturrelativismus vermieden werden, indem Stimmen aus China und Deutschland zu Wort kommen, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, ohne für ein ganzes Land sprechen zu wollen. China ist ein diverses Land mit 56 anerkannten Minderheiten, 22 Provinzen, 5 Autonomen Regionen, 2 Sonderverwaltungszonen und rund 1,4 Mrd. unterschiedlichen individuellen Persönlichkeiten. Eine Generalisierung soll vermieden und doch ein Verständnis für bestehende kulturelle Unterschiede sowie die Wichtigkeit eines sensiblen interkulturellen Austausches geschaffen werden.
Qu Yuan und Tao Yuanming: Kritiker des alten Chinas
Um ein Land besser zu verstehen, lohnt sich immer der Blick zurück auf die Geschichte. Kritik zielt darauf ab, etwas zu bewirken, zu verändern, zu verbessern und wer hätte dazu eher die Möglichkeit als jemand, der sich in der Umgebung derer bewegt, die er kritisiert. Qu Yuan 屈原, Literatenbeamter und Berater des Kaisers, hatte während der Zeit der Streitenden Reiche (475-221 v.Chr.) vor der Invasion des Qin-Staates gewarnt. Als der Kaiser sich nicht an seine Ratschläge hielt und ihn vom Hofe verbannte, kehrte Qu Yuan dem gesellschaftlichen Leben den Rücken zu, lebte im Exil und widmete sich der Poesie. Als der Qin-Staat tatsächlich in den Chu-Staat einmarschierte und sich die Warnung Qus als richtig herausstellte, ertränkte sich dieser in stillem Protest. Diesem großen Kritiker zu Ehren wird in China jährlich das bekannte Drachenbootfest gefeiert. Man erzählt sich, die Bewohner der Umgebung seien in der Hoffnung, ihn zu retten, in Drachenboote gestiegen, konnten den Selbstmord jedoch nicht verhindern.
Gut 600 Jahre später lebte in der Östlichen Jin-Dynastie (317-420 n.Chr.) ein anderer, bis heute bekannter Kritiker, namens Tao Yuanming 陶渊明. Dieser hatte ebenfalls seine Beamtenlaufbahn, von Falschheit und Korruption angewidert, beendet und ein Leben auf dem Land vorgezogen. Als Aussteiger und Selbstversorger widmete er sich ganz der Naturlyrik.
Kritik zu äußern, mal laut, mal leise, mal aktiv und mal passiv, direkt und indirekt, ist Teil der Geschichte Chinas, die bis heute am Leben erhalten wird. Die konfuzianische Tradition schrieb den Literatenbeamten vor, die Stimme zu erheben, wenn die Regierung von den konfuzianischen Idealen abwich. Herrschaftskritik zu äußern war nicht nur das Recht der Literatenbeamten, sondern ihre Pflicht. So lautet ein altes chinesisches Sprichwort: „Gute Medizin schmeckt bitter.“ Chin.:良药苦口利于病.
Gesichtswahrende indirekte Kritik
Ein weiterer wichtiger Aspekt der chinesischen Kritikfähigkeit, wie sie im Konfuzianismus auch heute noch gelehrt wird, ist die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird. In der chinesischen Kultur wird Kritik häufig indirekt ausgedrückt, um das Gesicht des Kritisierten zu wahren. Das Konzept der Wahrung des Gesichtes, zumindest in der Öffentlichkeit, ist bis heute ein prägender Aspekt der chinesischen Kommunikationskultur. Ein Gesichtsverlust, wird als äußerst schmerzhaft empfunden. Öffentlich Konflikte auszutragen könnte dazu führen, dass eine Person ihr Gesicht verliert, was vermieden werden sollte. Mit einer zurückhaltenden und subtilen Kritikäußerung sollen extreme Gegenreaktionen verhindert werden und das Gegenüber in Veränderungsprozesse einbezogen werden. Dies setzt voraus, dass die Kritik dennoch rezipiert wird. Grundsätzlich wird Kritik im Konfuzianismus als wichtiges Werkzeug für eine Veränderung zum Besseren angesehen. Sie hat also eine positive Funktion und dient zur Selbstkultivierung, die auf die Formung des Charakters abzielt. Hat diese philosophische Sicht auf Kritik im heutigen China immer noch ihren Platz?
In einer gesunden Gesellschaft sollte es nicht nur eine Stimme geben
Obwohl der Konfuzianismus die chinesische Gesellschaft bis in die Gegenwart mit stets wechselnder Intensität prägte, sind es die politischen Strukturen des kommunistischen Einparteienstaats, die kritische Äußerungen schwierig bis unmöglich machen. Schlupflöcher finden sich nichtsdestotrotz. Auf chinesischen Sozialen Medien werden Netizens sehr kreativ, um den Zensurapparat zu umgehen. Während „sensible Themen“, wie Tibet, Taiwan, Xinjiang und die Situation der Uiguren, kontroverse historische Ereignisse oder direkte Kritik an der Regierung in Echtzeit zensiert werden, schaffen es andere Themen, diese zumindest zeitweise zu umgehen und millionenfach geteilt zu werden.
So wurde zu Beginn der Coronapandemie ein Video der Ärztin Ai Fen 艾芬, die vor den Gefahren des neuartigen Virus´ warnte, innerhalb weniger Stunden transkribiert, in unterschiedlichste Sprachen übersetzt und sogar in Emojis und QR-Codes dargestellt, um sie weiter online teilen zu können. Die „Whistleblowerin“ äußerte sich daraufhin wie folgt: "Aber ich habe doch das Gefühl, die Sache hat gezeigt, dass man an seinem selbstständigen Denken festhalten muss, denn es muss Leute geben, die aufstehen und die Wahrheit sagen. In dieser Welt muss es verschiedene Stimmen geben, nicht?" Damit greift sie ein Zitat des an Corona verstorbenen Arztes Li Wenliang 李文亮 auf, der sagte: „In einer gesunden Gesellschaft sollte es nicht nur eine einzige Stimme geben.“ Ihr folgten zahlreiche Netizens mit Fotoaktionen, in denen das Recht auf „Redefreiheit“ eingefordert wurde.
Möglichkeiten der chinesischen Sprache
Indirekte kritische Andeutungen in chinesischen Online-Beiträgen werden von Außenstehenden meist nicht verstanden, geschweige denn richtig gedeutet. Um die eigene Meinung gefahrlos zu teilen, wird bspw. Bezug genommen auf Texte von Poeten oder Lyrikern des 20. Jahrhunderts, in denen offensichtliche thematische Parallelen zur Gegenwart hergestellt werden können. Ein unscheinbares Zitat kann so indirekte Kritik an aktuellen Gegebenheiten üben. Darüber hinaus erlaubt die chinesische Sprache Wortanlehnungen und Neologismen, die ihren Inhalt entweder in der Phonetik oder den Schriftzeichen transportieren. Während chinesische Muttersprachler:innen diese Anspielungen mit Leichtigkeit zu deuten wissen, entgehen anderen Leser:innen diese Nuancen. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, in China seine kritische Meinung kundzutun.
Viele junge Chines:innen folgen dem historischen Vorbild Tao Yuanmings und „liegen flach“ chin.: 躺平 tangping, sie entscheiden sich gegen eine Karriere und brechen aus dem vorgeschriebenen Gesellschaftssystem aus. Bei der Tangping-Bewegung stehen der Wunsch nach mehr Zeit für sich sowie ein stiller Protest gegen den, in der Gesellschaft vorherrschenden Leistungsdruck im Vordergrund. Für immer mehr Chinesinnen und Chinesen bedeutet mehr materieller Wohlstand nicht automatisch mehr Lebensqualität. Tangping wurde so zum Gegenentwurf einer Art zu leben, und zum sozialen Protest gegen Überstunden und die sogenannte 996-Arbeitskultur. Das bedeutet von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends zu arbeiten – sechs Tage die Woche.
Bis hinter die eigenen Landesgrenzen führt es Chines:innen, die der „Lehre des Wegrennens“ chin. 润学 runxue (engl.: runology) folgen. Der Neologismus beschreibt das Verlassen Chinas aufgrund von großer sozialer und politischer Unzufriedenheit, die bspw. mit den erheblichen Einschränkungen der Zero Covid Politik einherging. Das chinesisch ausgesprochene “run“ bedeutet eigentlich „Profit“, greift dabei aber phonetisch das englische Wort für „rennen“ auf. Wie David Bandurski für das China Media Project schreibt, hält es einen weiteren potentiellen Lebensweg für vor allem junge Chines:innen fest: die Auswanderung.
Besonderheiten chinesischer Proteste
Auch in China gibt es Proteste und Demonstrationen als Ausdruck des Widerspruchs oder der Ablehnung gegenüber einer bestimmten Situation, einer Handlung, einer Entscheidung oder einer politischen, sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Angelegenheit. Allgemein gesagt ist der Protest eine Form des öffentlichen oder privaten Ausdrucks von Unzufriedenheit oder Unmut, die Menschen nutzen, um auf Missstände oder Probleme aufmerksam zu machen und Veränderungen herbeizuführen. Wie der Report des China Dissent Monitors zeigt, richtet sich ein Großteil der Proteste in der VRCh gegen die Lokalregierung oder explizite Themen (wie einzelne Bauvorhaben, Umweltverstöße, Zahlungsausfälle in Firmen etc.) und sind verhältnismäßig klein. Mehr als die Hälfte der Proteste haben nur 10-99 Teilnehmer:innen. Zwischen Juni ´22 und April ´23 wurden mehr als zweitausend Ereignisse dokumentiert. Laut des Berichts sind Verhaftungen der Teilnehmenden wahrscheinlicher, richtet sich der Protest gegen die (Lokal)Regierung.
In China kam es im November letzten Jahres zu den sogenannten White-Paper-Demonstrationen, die sich gegen die restriktiven Maßnahmen der Zero-Covid-Politik richteten. Weiße DinA4 Papiere wurden als Zeichen der wachsenden kollektiven Sprachlosigkeit zum Symbol der Bewegung. In ironisch anmutendem vorauseilendem Gehorsam zensierten sich die Teilnehmenden selbst und schafften es doch die Regierung so auf die Missstände, die mit den Lockdowns und Einschränkungen der Corona-Maßnahmen einher gingen, aufmerksam zu machen und Druck auszuüben. Auch hier war es größtenteils die junge Bevölkerung, die sich an den Protesten beteiligte. Ihre Kritik richtete sich hauptsächlich gegen die Corona-Maßnahmen, und somit nur indirekt gegen die Regierung.
Dr. Lei Zhou über die chinesische Konfliktkultur
Im Interview beschreibt uns der Design-Anthropologe, Wasserschützer und Künstler Dr. Lei Zhou seine Erfahrungen mit der Konflikt- und Streitkultur im chinesischen Alltag. Für ihn persönlich ist das Nichts-Sagen die häufigste und lauteste Form der Kritik. Wird in einem Gespräch eine Äußerung ignoriert oder übergangen, sei dies ein klarer Indikator dafür, dass der Konversationspartner dieser sehr kritisch gegenüberstehe. Häufig spielt auch die Körpersprache dabei eine wichtige Rolle: Diese ist dann äußerst zurückhaltend, gar erstarrt.
In China bestehe ein Bewusstsein dafür, dass man nicht die erste Person sein sollte, die eine kontroverse Meinung öffentlich teilt. Es sei allgemein bekannt: „Die Schüsse richten sich immer gegen die Ersten, die ihrer Meinung Gehör verschaffen!“ Die Erfahrung vieler in China ist daher: Offene Kritik ist möglich, solange sie nicht öffentlich gemacht wird. Kontroverse Meinungen werden möglichst im Verborgenen gehalten – und es wird gezielt an Lösungen gearbeitet. Selbst mit engen Freunden werden kritische Ansichten nicht selbstverständlich geteilt. Systemkritik ist ohne Kontakte, chin. 关系 guanxi so gut wie gar nicht möglich. Laut Dr. Lei werde Kritik gezielt an eine Schlüsselperson herangetragen, die Macht und Einfluss hat, eine Änderung zu bewirken. Gerahmt in konstruktiven Verbesserungsvorschlägen wird die Kritik geäußert, ohne sie für Missstände verantwortlich zu machen. Dies beobachten wir immer wieder in der Arbeit chinesischer NGOs, die kooperativ mit einzelnen Stakeholdern in Regierungsstrukturen oder Unternehmen arbeiten, um Wirkungen zu erzielen.
Im Gegensatz zu Deutschland werde das Schüren eines Flächenbrands, so Zhou Lei, in Form eines sozialen Aufschreis selbst von den Kritik-Übenden nicht angestrebt, da die persönlichen Folgen verheerend sein können. Es werde stets abgewägt, wie weit die Diskussion in die Gesellschaft gestreut werden sollte, um einen Wandel herbeizuführen. Gerade von Seiten der Parteikader bestehe ein großes Interesse daran, Unzufriedenheiten und Probleme im Keim zu ersticken, bevor sie zu einer größeren, nicht mehr zu kontrollierenden Bewegung werden. „Wir mögen in China die Vorstellung, von einem intelligenten, kompetenten Führer regiert zu werden. Erfüllt dieser nicht unsere Erwartungen, schnallen wir uns an und versuchen mit der Situation zu leben.“, so Lei. Nichtsdestotrotz gibt es auch in China Menschen, die viel riskieren, um etwas zu verändern – und sei es nur ein kleines Stück. Lu Xun, berühmter Schriftsteller und Begründer der modernen chinesischen Literatur habe einst gesagt, dass China so schwer zu verändern sei, dass selbst das Verschieben eines Tisches Blut erfordere; und selbst mit Blut sei es nicht immer möglich, etwas zu bewegen und zu verändern.
Gemeinsame Ziele im interkulturellen Dialog
Den Teilnehmenden unseres Kurses im Rahmen der Einsteigerakademie China wurde deutlich, dass es viele interkulturelle Fallstricke zu beachten gibt, die zu Missverständnissen führen können. Besonders wenn es um sensible Themen geht. Die anfängliche Meinung, dass es in China keine Kritik gäbe, wich einem weiter gefassten Verständnis von Kritikäußerung. Um gemeinsam an Zielen zu arbeiten, wie z.B. der Klimawandelbekämpfung und Kooperationen in der Forschung fortführen zu können, ist ein Dialog basierend auf gegenseitigem Verständnis von größter Bedeutung. Verständnis ist nicht zwingend Einverständnis. Aus diesem Grund definieren wir die Beziehung zu China in Europa seit einigen Jahren mit dem Dreiklang, Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.
Der Artikel soll einen Beitrag dazu leisten, ein Bewusstsein für die Andersartigkeit der Kritikäußerungen in China zu erlangen und so die Pluralität der chinesischen Gesellschaft und die Arbeit besonders der Aktivistinnen und Aktivisten in der Zivilgesellschaft ein wenig sichtbarer machen. Zur Arbeit des China-Programms gehört unter anderem das Eröffnen, Erhalten und Ausweiten von zivilgesellschaftlichen Dialog- und Handlungsspielräumen - ohne die zahlreichen Kritiker:innen Chinas wäre dies nicht möglich.
Weiterführende Lektüre: Roetz, Heiner: "Kritik im alten und modernen China" (2006)